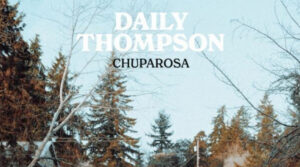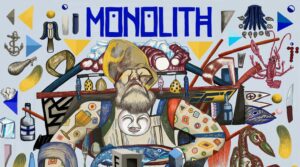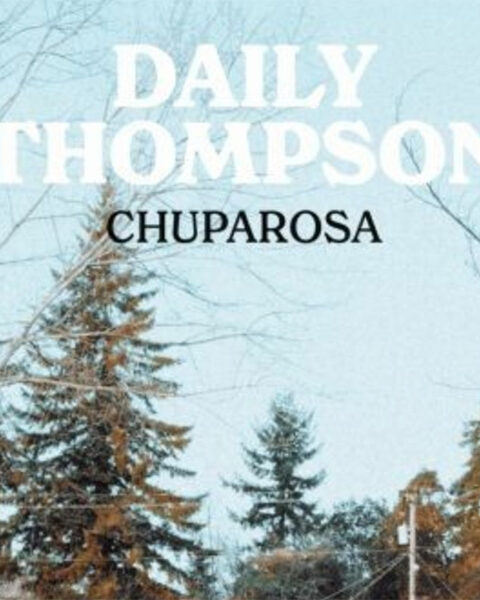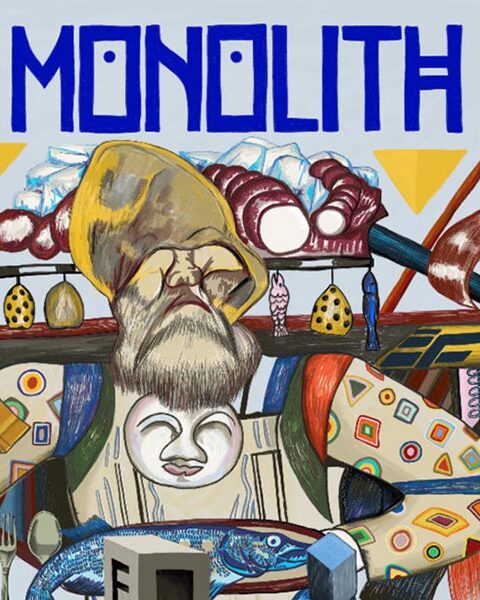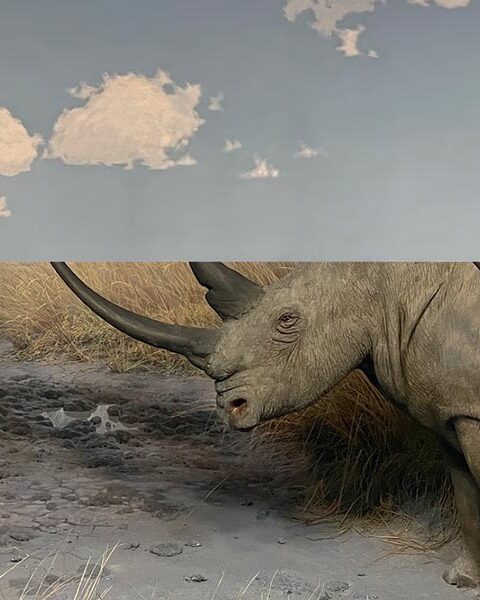Die Australier scheuen sich nicht davor, ihren Post-Rock-Sound mit einer Portion Pop-Appeal zu unterfüttern. Das macht "It’s Here, But I Have No Names For It" zu einer Scheibe für die vorderen Plätze der Jahresendlisten 2024.
26. April Hallway
Holt die Partyhüte raus, setzt eure feinsten Ohrstöpsel ein und findet euch am 26.04. im Import Export zusammen – es gibt einen feierlichen Anlass im Hause new basement. Live: Hallway, The Sounds They Made und Hard Drive Recovery Club. Wir verlosen Freikarten!