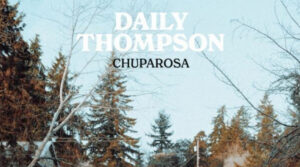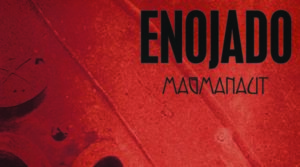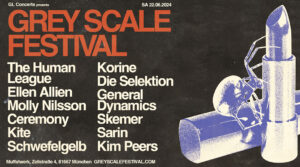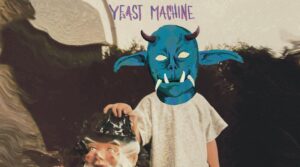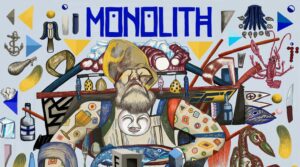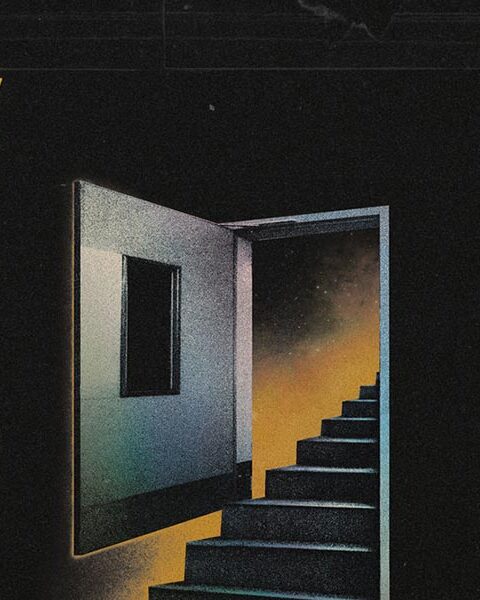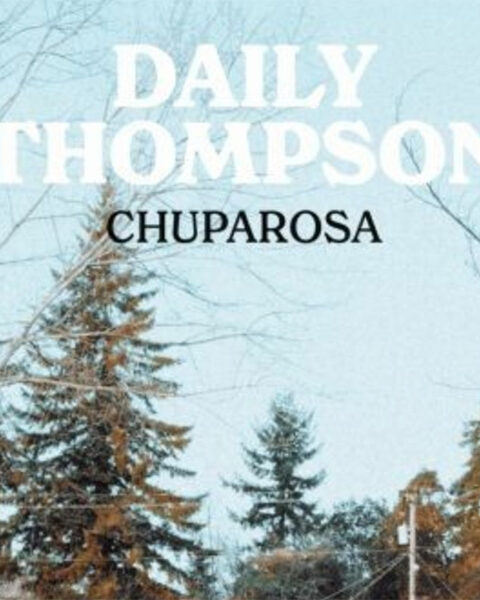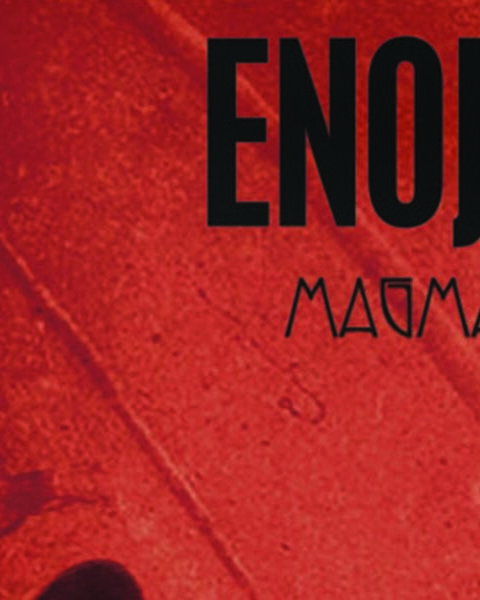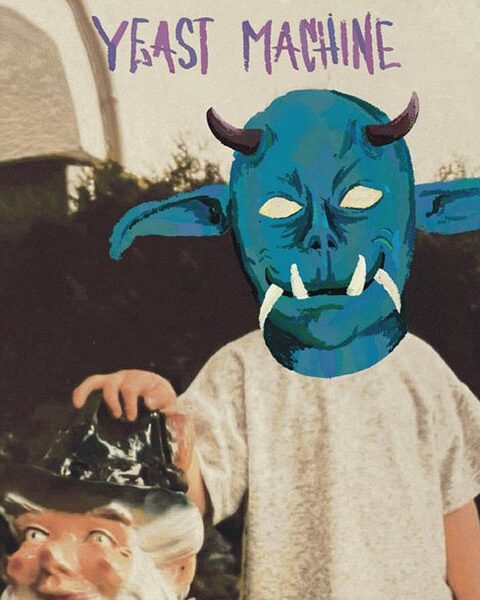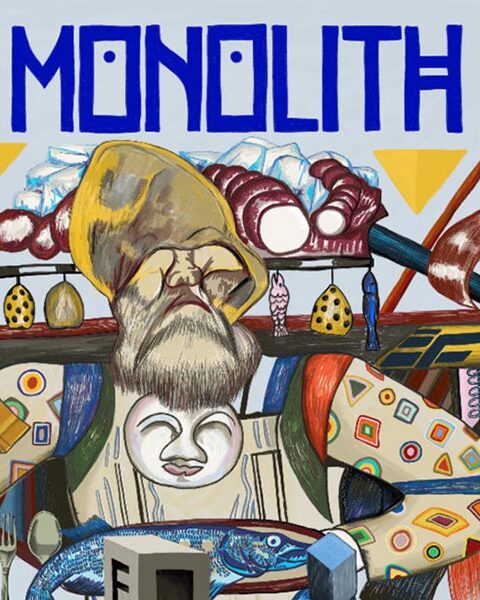Das Quartett feiert heuer 20-jährigen Geburtstag. Album Nr. 4 geht den Weg des 90er Jahre Alternative, Indie, Punk Hardcore Sounds geradeaus weiter.
26. April Hallway
Holt die Partyhüte raus, setzt eure feinsten Ohrstöpsel ein und findet euch am 26.04. im Import Export zusammen – es gibt einen feierlichen Anlass im Hause new basement. Live: Hallway, The Sounds They Made und Hard Drive Recovery Club. Wir verlosen Freikarten!